Glarner in fremden Diensten: Eine Geschichte von Krieg, Geld und Macht
- Patrick

- 8. Dez. 2024
- 5 Min. Lesezeit
Julia Rhyner-Leisinger, Artikel in der Südostschweiz vom 2.12.2024. (Publikation mit freundlicher Genehmigung der Autorin und des Verlags)
Im 15. und 16. Jahrhundert entwickelte sich in der Eidgenossenschaft ein florierendes Geschäft: der Export von Söldnern. Auch für den Kanton Glarus spielten die fremden Dienste eine wichtige Rolle. Tausende Glarner zogen in französische Kriegsdienste, lockten doch gute Bezahlung und die Aussicht auf Abenteuer.

Verteilung der Pensionen für fremde Dienste. Die eidgenössischen Gesandten erhalten das vom König von Frankreich bezahlte Geld und nehmen es in ihren Hüten mit. Illustration aus der Luzerner Chronik von Diebold Schilling, 1513 (Zentral- und Hochschulbibliothek Luzern, Sondersammlung, Eigentum Korporation Luzern).
Schweiz als Zentrum der Kriegswirtschaft
Im Herzen Europas gelegen, nahm die Eidgenossenschaft in der Frühen Neuzeit eine Doppelrolle ein: einerseits als neutraler «stillesitzender» Staat, andererseits als wichtiger Mitspieler auf den europäischen Kriegsschauplätzen. Die Schweiz entwickelte sich zwischen den Großmächten Habsburg und Frankreich zu einer Drehscheibe für Kriegswirtschaft und -finanzierung. Hier stellten Militärunternehmer, Söldner, Fabrikanten, Händler und Investoren ihre Dienste den kriegführenden Mächten zur Verfügung. Für die benachbarten Großmächte wurde die Eidgenossenschaft zu einem unentbehrlichen Partner: als florierender Söldnermarkt, als sicherheitspolitische Pufferzone, als sicheres Durchmarschgebiet für Armeen, als Handelsplatz für Kriegsmaterial und als Bühne für diplomatische und geheimdienstliche Aktivitäten.
Schweizer Söldner waren in ganz Europa gefragt. Sie galten als zuverlässig und gut ausgebildet. Schätzungen zufolge standen um 1500 bei einer Gesamtbevölkerung von 600’000 etwa 10-12% der Schweizer Gesamtbevölkerung in fremden Diensten. Über die Jahrhunderte hinweg sollen es mehr als eine Million Schweizer Söldner gewesen sein. Zu den wichtigsten eidgenössischen Bündnispartner gehörte Frankreich – das erste Bündnis mit dem französischen König wurde 1521 abgeschlossen und bis ins 18. Jahrhundert immer wieder erneuert. Der französische König durfte fortan in den Kantonen Truppen anwerben – und zahlte im Gegenzug viel Geld.

Schweizer Söldner beim Überqueren der Alpen. Farbige Illustration, 1513, in der eidgenössischen Chronik des Luzerners Diebold Schilling «Diebold Schilling-Chronik 1513», Eigentum Korporation Luzern (Standort: ZHB Luzern, Sondersammlung).
Pensionen: Geldfluss aus dem Ausland
Einerseits flossen offizielle «Standesgelder», sogenannte Pensionen, an die eidgenössischen Orte. In Luzern machten die offiziellen Standespensionen über die Hälfte der Staatseinnahmen aus. Kleinere Orte wie Zug, Schwyz und Solothurn finanzierten mehr als ein Drittel ihres Haushalts mit französischem Geld. Für Glarus ermöglichte die erste französische Pensionszahlung im Jahr 1517 eine Expansionsmöglichkeit, nämlich den Kauf der Kauf der Grafschaft Werdenberg, die fortan über 300 Jahre als Vogtei verwaltet wurde. Aber auch der Glarner Durchschnittsbürger profitierte: 1543 erhielt in Glarus jeder stimmberechtigte Einwohner eine halbe Krone als „Rodelpension“. Für die meisten Leute war flüssiges Geld rar, so dass dieses französische Geld die lokale Wirtschaft belebte.
Doch das grösste Geldverteilen fand im Verborgenen statt. Die sogenannten Partikularpensionen waren geheime Zahlungen an einflussreiche „Networker“, die sich für die Durchsetzung französischer Interessen einsetzen. Militärunternehmer, Diplomaten und Ratsherren wurden so in kurzer Zeit zu Großverdienern und konnten von diesen Pensionsgeldern dauerhaft leben.

Begrüssung der Schweizer Söldner, darunter auch Glarner, durch den französischen König [Ludwig XI. im August 1480 vor Chalon-sur-Saône]. Die Söldnerkontingente der acht Orte, die ihre Banner hochhalten, werden vom König auf der Zugbrücke empfangen. Illustration aus der Luzerner Chronik von Diebold Schilling, 1513 (Zentral- und Hochschulbibliothek Luzern, Sondersammlung, Eigentum Korporation Luzern).
Glarus im Dienst des Königs
Die Autorin dieses Artikels präsentierte an der kürzlich stattgefundenen Veranstaltung des Historischen Vereins Glarus ihre Forschungsergebnisse zu den Glarner Solddiensten am Übergang vom Spätmittealter zur Frühen Neuzeit. Wie in vielen anderen, vornehmlich katholischen Orten waren die fremden Dienste auch in Glarus populär. Im Jahr 1544 sollen beispielsweise bei der Schlacht von Ceresole im Piemont so viele Glarner gedient haben, dass der Landammann die Landsgemeinde nicht einberufen konnte. Die fremden Dienste stellten für den Durchschnittsbürger eine gut bezahlte Erwerbsmöglichkeit dar, machten sie doch im 16. Jahrhundert das doppelte eines einfachen landwirtschaftlichen Arbeiters aus. Aber auch die politische Führungsschicht machte mit dem Krieg das Geschäft. Als Militärunternehmer vertraten viele Ratsherren französische Interessen oder führten Regimenter mit eigens dafür rekrutierten Söldnern in den Krieg.
Die Korrespondenz aus dieser Zeit – zum Beispiel Briefe von Hauptleuten, die aus dem Kriegsfeld berichten oder Schreiben zwischen Glarus und Frankreich zur Aushandlung von Soldverträgen – zeigt auf, dass die Glarner Obrigkeit im 16. Jahrhundert eng mit dem Soldwesen verbunden war. Zu den führenden «Glarner Kronenfressern» um 1550 zählten beispielsweise die Familien Bäldi, Hässi, Vogel und Tschudi.
Die Familie Tschudi und das Geschäft mit dem Krieg
Die Familie Tschudi gehörte zu den einflussreichsten Familien im Glarnerland. Die Tschudis nutzten das Kriegsgeschäft, um ihre wirtschaftliche und politische Macht zu festigen und auszubauen. Dazu führten sie ein Familienunternehmen, dem als Familienhaupt «Ludwig Tschudi dem Älteren» (1462-1534) vorstand und zu dem neben dem Soldgeschäft die Verwaltung des Kernbesitzes gehörte. Dies umfasste das Schloss und die Herrschaft Gräpplang bei Flums, die wie damals üblich patrilinear an den ältesten Sohn vererbt wurde. Um alle politischen, administrativen, diplomatischen und wirtschaftlichen Aufgaben des Familienunternehmens erfolgreich zu bewältigen, war der Haupterbe des Familienbesitzes aber auf ein breites Netzwerk von Verwandten angewiesen. In der Familie Tschudi trugen die 15 Kinder des Ludwigs Tschudi mit unterschiedlichen Funktionen zum Erfolg des Familienunternehmens bei.
Ägidius Tschudi als französischer Netzwerker
Ägidius Tschudi (1505-1572), das jüngste Kind aus der ersten Ehe seines Vaters, übernahm als Diplomat eine zentrale Rolle im familiären Netzwerk. Bekannt wurde er vor allem als Politiker und Historiker, insbesondere durch seine bedeutende Schweizerchronik «Chronicon Helveticum». Als führender Politiker in Glarus und Landvogt der angesehenen gemeineidgenössischen Vogtei Baden war er bestens informiert in Politik, Diplomatie, Militär und Wirtschaft und zählte zu den wichtigsten Glarner Verhandlungspartnern für Frankreich. Tschudi setzte seine Expertise und sein weitreichendes Netzwerk gezielt ein, um französische Interessen in Glarus zu fördern. Im Gegenzug erhielt er großzügige Pensionszahlungen aus Frankreich.
Diese Gelder waren mehr als nur Einkommen – sie waren ein machtvolles Instrument, das Tschudi nach Belieben einsetzen und mit dem er Anhänger und Verwandte begünstigen konnte. Die Teilnahme an den französischen Kriegszügen überliess er dann gerne seinen Brüdern und Halbbrüdern. Mehrere seiner Familienmitglieder absolvierten eine glänzende militärische Karriere. Insbesondere sein Halbbruder Jost Tschudi (1511-1566) diente dem französischen König auf diversen Kriegszügen und befehligte als Oberst zeitweise mehrere Tausend Eidgenossen. Selbstverständlich sorgten die Tschudis dafür, dass die meisten ihrer Regimenter von Familienmitgliedern und weiteren Glarner Hauptleuten kommandiert wurden.
Wie Söldnerdienste die Schweiz prägten
Das Beispiel des Familienunternehmens der Tschudis verdeutlicht, wie eng wirtschaftliche, politische und militärische Interessen in der Frühen Neuzeit miteinander verknüpft waren. Über Generationen hinweg betrieben die Tschudis eine erfolgreiche Familienpolitik und stellten 17 Landammänner, Landvögte und zahlreiche Mitglieder in politischen Ämtern. Rund 170 Familienangehörige dienten zudem als Offiziere in ausländischen Armeen. Erst mit der Bundesverfassung 1848 wurde das Geschäft mit den fremden Diensten in der Schweiz verboten. Bis dahin jedoch füllte das fremde Geld die eidgenössischen Staatskassen. Während andere Nationen enorme Summen in den Unterhalt ihrer Armeen investierten, vermarktete die Eidgenossenschaft die Kriegsdienste ihrer Söldner und konnte damit auf direkte Steuern und den kostspieligen Unterhalt eines eigenen stehenden Heeres verzichten. Der Preis für diesen Wohlstand war aber hoch. Viele Eidgenossen starben auf ausländischen Schlachtfeldern. Gemäss einer Statistik des Zürcher Pfarrers Johann Heinrich Waser (1742– 1780) kehrten von den rund 1,1 Millionen Schweizer Söldnern, die zwischen dem 15. und 18. Jahrhundert dem französischen König dienten, nur 480 000 in die Schweiz zurück, davon 160 000 invalid und verwahrlost. Lediglich 320 000 waren noch fürs Zivilleben tauglich. Ein Teil der Grundlage der modernen, „neutralen“ Schweiz wurde somit auf ausländischem Geld errichtet – bezahlt mit dem Blut ihrer Söldner.

Die eidgenössisch-französische Soldallianz von 1521. Befindet sich im Staatsarchiv Luzern.
Julia Rhyner-Leisinger ist gebürtige Glarnerin, studierte Historikerin und begeisterte Geschichtslehrerin. Nach mehreren Jahren in Zürich, St. Gallen und São Paulo lebt sie mit ihrem Mann und ihren Kindern wieder im Glarnerland. In ihrer Freizeit ist sie engagierte Stadtführerin und gibt ihr Wissen über die spannende Geschichte der Region gerne weiter. Wenn Sie an einer spannenden Führung interessiert sind, besuchen Sie Julias Website: https://juliarhyner.com.


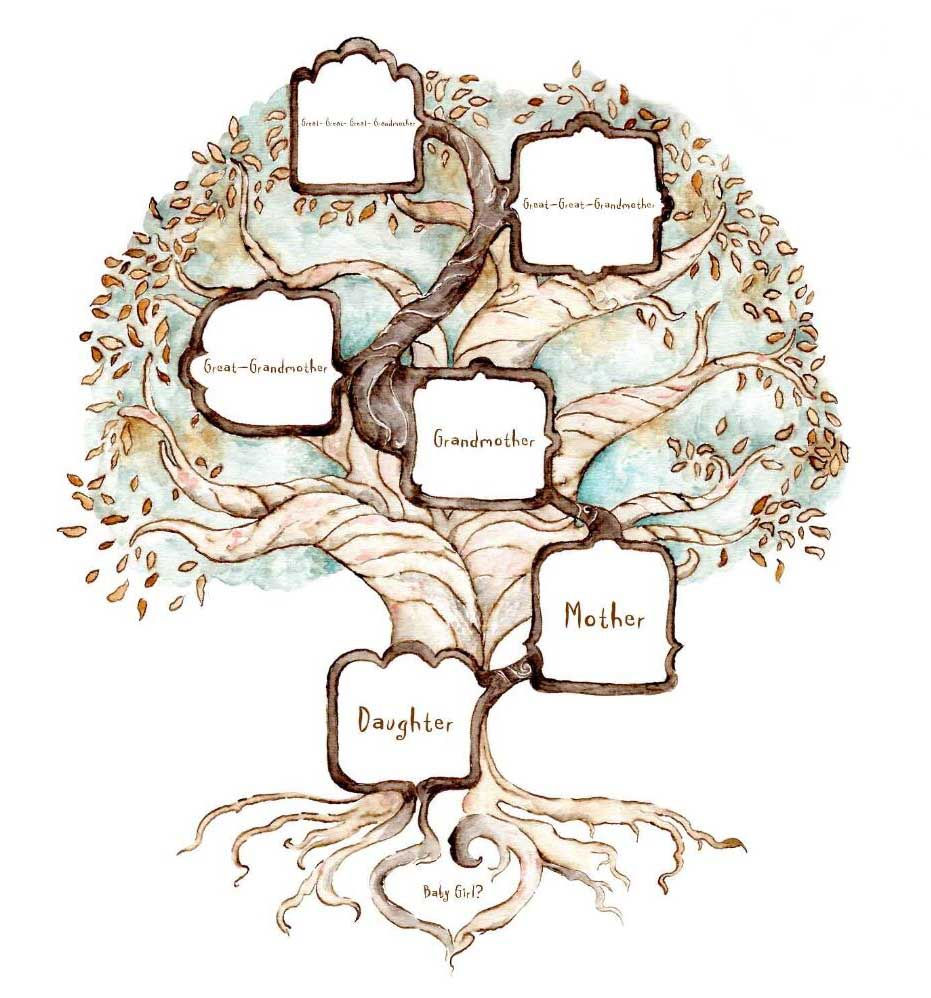
Kommentare