Genealogie als Forschungsinstrument: Der Glarner Stammbaum als Grundlage für in-terdisziplinäre Analysen in einem alpinen Mikroraum
- Patrick

- 27. Juli
- 9 Min. Lesezeit

Dieser Artikel stellt eine genealogische Datenbank vor, die auf jahrzehntelanger Forschung zur Bevölkerung des Schweizer Kantons Glarus basiert. Die Datenbank umfasst über 366'000 Personen (Stand Juli 2025), deren familiäre Verbindungen bis weit über das 16. Jahrhundert zurückverfolgt werden können. Durch die vollständige Erfassung und Vernetzung der lokalen Bevölkerung über mehr als 15 Generationen hinweg bietet dieses Instrument eine einzigartige Grundlage für demografische, soziologische, historische, genetische und migrationsbezogene Forschungen. Der Artikel untersucht das wissenschaftliche Potenzial dieser Datenbank im Kontext der besonderen historischen und geographischen Bedingungen des Kantons Glarus, einem kleinräumigen und bis ins 20. Jahrhundert hinein vergleichsweise isolierten Alpenkanton.
1. Einleitung
Genealogische Forschung wird traditionell als ein Instrument der Familien- und Regionalgeschichte verstanden. In jüngerer Zeit erfährt sie jedoch verstärkt Anerkennung als Grundlage interdisziplinärer wissenschaftlicher Analyse. Besonders dann, wenn genealogische Daten systematisch und in großer Tiefe erhoben werden, wie im Fall des vorliegenden Glarner Stammbaums, eröffnen sich weitreichende Anwendungsmöglichkeiten. Dieser Beitrag beleuchtet den wissenschaftlichen Wert eines genealogischen Großprojekts, das aus der langjährigen Erforschung der Abstammungslinien der Glarner Bevölkerung hervorgegangen ist.
2. Der Glarner Stammbaum: Aufbau und Umfang
Die Datenbank basiert auf der vollständigen Auswertung der Kirchenbücher des Kantons Glarus, beginnend im 16. Jahrhundert. Sie erfasst:
über 366'000 Personen (Stand Juli 2025),
deren familiäre Verbindungen (Eltern, Ehepartner, Kinder),
sowie Informationen zu Lebensdaten, Berufen, Auswanderung und Herkunft.
Fast alle erfassten Individuen sind miteinander genealogisch verknüpft, was eine flächendeckende Analyse von Abstammung und Verwandtschaftsstrukturen erlaubt. Der Glarner Stammbaum ist somit nicht nur eine Sammlung von Daten, sondern ein vollständiges genealogisches Modell eines alpinen Mikroraums über einen Zeitraum von fast 500 Jahren.
3. Der Kanton Glarus als Forschungsraum
Der Kanton Glarus bietet für genealogische und interdisziplinäre Forschungen ein besonders geeignetes Untersuchungsfeld. Seine geografische, historische und soziale Struktur machen ihn zu einem Mikrokosmos, der in vielerlei Hinsicht modellhaft analysiert werden kann. Die Kombination aus überschaubarer Bevölkerungszahl, guter Quellenlage, hoher genealogischer Dichte und relativer Isolation bis in die Moderne ermöglicht präzise und belastbare Aussagen über langfristige demografische, soziale und kulturelle Entwicklungen.
Der Kanton liegt in den Schweizer Alpen und ist geprägt durch enge Täler, Gebirgszüge und begrenzte bewohnbare Flächen. Diese natürlichen Bedingungen führten zu einer historisch begrenzten Mobilität der Bevölkerung. Viele Familien lebten über Jahrhunderte hinweg am gleichen Ort. Die Bevölkerung wuchs dabei nur moderat – von ca. 7'000 im 16. Jahrhundert auf ca. 42'000 heute. Die starke Lokalbindung, insbesondere innerhalb der Kirchgemeinden, begünstigte endogame Heiratsmuster und stabile Verwandtschaftsstrukturen, die heute genealogisch sehr gut nachvollzogen werden können.
Gesellschaftlich war Glarus durch eine relativ egalitäre Struktur gekennzeichnet. Die Landsgemeinde als frühe Form der direkten Demokratie existierte seit dem 17. Jahrhundert. Viele Familien übten über Generationen hinweg dieselben Berufe aus – etwa in der Landwirtschaft, im Handwerk oder in der Textilproduktion, die seit dem 18. Jahrhundert an Bedeutung gewann. Die familiären und sozialen Netzwerke, die daraus entstanden, lassen sich im Glarner Stammbaum über viele Generationen hinweg analysieren.
Die Quellenlage ist außerordentlich gut: Die Kirchenbücher beginnen bereits im 16. Jahrhundert und bieten zusammen mit späteren Zivilstandsregistern, Steuerlisten, Gerichtsprotokollen und dem nachfolgend besprochenen genealogischen Werk von Johann Jakob Kubly-Müller eine hohe Datendichte. Da die Zahl der Kirchgemeinden überschaubar ist und viele Familiennamen über Jahrhunderte bestehen bleiben, lassen sich nahezu vollständige Abstammungslinien rekonstruieren.
Ein bedeutender Aspekt in der Geschichte des Kantons ist die Auswanderung. Nach dem Dreissigjährigen Krieg verließen erste Gruppen den Kanton, um in den vom Krieg entvölkerten Gebieten eine neue Wirtschaftsgrundlage zu finden. Später dann um in fremde Militärdienste oder Handelsbeziehungen zu treten. Die deutlich größere Auswanderungswelle folgte jedoch im 19. Jahrhundert. Zwischen etwa 1840 und 1880 emigrierten viele Glarner Familien nach Nordamerika – insbesondere nach Wisconsin, aber auch nach Südamerika und Russland. Die Ursachen lagen in wirtschaftlichen Krisen, Armut und politischen Umbrüchen. Die Spuren dieser Auswanderer lassen sich im Glarner Stammbaum verfolgen, und die Nachkommen dieser Emigranten bilden bis heute weitverzweigte Linien in der Diaspora.
Durch die relative geografische Isolation des Kantons bis ins 20. Jahrhundert hinein sowie die durch Dokumente klar nachvollziehbare Auswanderungsgeschichte eignet sich Glarus als Modellregion für historisch-demografische Mikrostudien. Der Glarner Stammbaum erlaubt die Rekonstruktion sozialer Mobilität, die Analyse genetischer Muster und den Vergleich zwischen sesshaften Linien und Auswandererfamilien. Damit ist der Kanton Glarus nicht nur von regionalem, sondern auch von internationalem wissenschaftlichem Interesse.
5. Das genealogische Werk von Johann Jakob Kubly-Müller (1850-1933) und der digitale Glarner Stammbaum
Das genealogische Werk von Johann Jakob Kubly-Müller stellt eine der bedeutendsten Grundlagen für die Familienforschung der rund 200 Familien aus dem Kanton Glarus dar. In jahrzehntelanger Arbeit wertete er die Kirchenbücher der Glarner Kirchgemeinden aus und fasste die darin enthaltenen genealogischen Informationen nach Familiennamen und nach Kirchgemeinden systematisch zusammen. Seine handschriftlichen Kompendien bieten eine nahezu vollständige Übersicht über die familiären Verhältnisse der Glarner Bevölkerung vom Beginn der Kirchenbuchaufzeichnungen im 16. Jahrhundert bis ins 20. Jahrhundert.
In mehr als 30 Jahren Arbeit (1893-1923) hat Kubly-Müller dieses einzigartige Nachschlagewerk geschaffen. Es umfasst insgesamt 36 große und kleine Bände sowie das Register für die ältere Glarner Genealogie und ein alphabetisches Verzeichnis. Kubly Müllers monumentales Werk, das auf dem gesamten Bestand der Pfarrbücher des Kantons Glarus aufbaut und durch historische Verzeichnisse, Dokumente und Materialien aus öffentlichen und privaten Archiven ergänzt wird, listet alle Glarner Familien vom 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart in ihrer Abfolge auf und verbindet sie in einer sauberen und lesbaren Schrift. Nach seinem Tod von Johann Jakob Kubly-Müller und dem Verkauf des Werks an den Kanton scheinen die jeweiligen Landesarchivare bzw. Bibliothekare bzw. deren Mitarbeiter die Geburten, Todesfälle und Heiraten aufgrund der amtlichen Mitteilungen nachgeführt zu haben. Die Kubly-Müller-Bände mit allen Familieninformationen werden im Landesarchiv in Glarus aufbewahrt.
Besonders hervorzuheben ist die Ordnung nach Kirchgemeinden, welche die lokale Verankerung der Familien sichtbar macht. Sie ermöglicht es, historische sozialräumliche Strukturen nachzuvollziehen und Entwicklungen auf Gemeindeebene zu analysieren. Auch die Bewahrung der Kirchenbuchdaten in einer zugänglichen Form ist ein bedeutender Beitrag zur historischen Quellenpflege, insbesondere da manche Originale heute schwer lesbar, beschädigt oder verschollen sind.
Trotz der enormen Sorgfalt und Tiefe bleibt das Werk von Kubly-Müller ein analoges Hilfsmittel mit gewissen Einschränkungen für komplexere, computergestützte Analysen – wie etwa Verwandtschaftsnetzwerke, interkommunale Heiratsverflechtungen oder statistische Auswertungen über mehrere Generationen hinweg.
Genau hier setzt der digitale Glarner Stammbaum an. Aufbauend auf der Arbeit von Kubly-Müller wurde und wird eine umfassende genealogische Datenbank geschaffen, die alle erfassten Personen miteinander verlinkt, digitale Such- und Analysemöglichkeiten bietet und zugleich auf die dokumentarische Tiefe der traditionellen Quellenforschung zurückgreift. Der digitale Stammbaum baut damit die Brücke zwischen klassischer, manuell erschlossener Genealogie und den Möglichkeiten der modernen digitalen Forschung.
In diesem Zusammenspiel entsteht ein innovatives Werkzeug für Forschung und Lehre, das die historische Tiefe mit der technischen Flexibilität verbindet und das genealogische Erbe des Kantons Glarus zukunftsfähig macht.
6. Interdisziplinäre Nutzungsmöglichkeiten
Die genealogische Datenbank des Glarner Stammbaums bietet eine einzigartige Grundlage für interdisziplinäre Forschung. Aufgrund ihrer außergewöhnlichen Tiefe, Vollständigkeit und der systematischen Verknüpfung von mehr als 366'000 Personen über 15 Generationen hinweg eignet sich dieses Instrument für eine Vielzahl von wissenschaftlichen Fragestellungen. Im Folgenden werden fünf besonders relevante Disziplinen mit ihren Nutzungsmöglichkeiten beschrieben:
6.1 Demografie und historische Bevölkerungsgeschichte
Der Glarner Stammbaum ermöglicht detaillierte demografische Analysen über einen Zeitraum von fast 500 Jahren:
Langzeitstudien zu Geburten- und Sterberaten, durchschnittlichen Heirats- und Sterbealter, Kinderzahlen pro Familie und deren Entwicklung.
Untersuchung der Auswirkungen von Krisenereignissen wie Seuchen, Hungersnöten oder Kriegen (z. B. Dreißigjähriger Krieg, Spanische Grippe) auf die Bevölkerungsstruktur.
Analyse von Heiratsmustern, Wiederverheiratungsquoten, Witwenstand und der Rolle des sozialen Umfelds bei Partnerwahl.
Durch die lückenlose Verknüpfung lässt sich erforschen, wie sich bestimmte demografische Indikatoren in verschiedenen sozialen Gruppen oder Kirchgemeinden unterschieden und wie sie sich im Laufe der Zeit veränderten.
6.2 Migrations- und Auswanderungsforschung
Die detaillierte Erfassung der Auswanderer aus dem Kanton Glarus ist ein zentrales Element der Datenbank:
Nachvollziehbarkeit individueller und familiärer Migrationspfade, etwa nach Nordamerika, Russland oder Südamerika.
Identifikation von Push- und Pull-Faktoren: Wer wanderte wann, warum und wohin aus? Welche Rolle spielten familiäre Vorbelastungen, Armut oder politische Entwicklungen?
Vergleich der sozialen Entwicklung der Ausgewanderten mit den Daheimgebliebenen (z. B. in Bezug auf Familiengröße, Bildung oder Berufslaufbahn).
Die Datenbank erlaubt es zudem, transnationale Netzwerke zu analysieren – etwa durch Briefe, Rückkehrmigration oder Heiratsverbindungen zwischen Diaspora und Herkunftsregion.
6.3 Genetik, Medizin und Anthropologie
In stabilen, über lange Zeit isolierten Populationen wie im Glarnerland lassen sich genetische Muster und Vererbungsprozesse besonders gut untersuchen:
Erforschung von Erbkrankheiten (z. B. Stoffwechselerkrankungen, Hörverlust, seltene genetische Syndrome) anhand genealogischer Linien.
Modellierung genetischer Übertragungswege durch segregierte Linien, um genetische Prädispositionen über viele Generationen zurückzuverfolgen.
Unterstützung medizinischer Studien durch Zugang zu dokumentierten Abstammungslinien, etwa für molekulargenetische Forschung mit ethischer Rückbindung.
Der Glarner Stammbaum stellt eine wertvolle Ergänzung zu biomedizinischen Studien dar – etwa in Kooperation mit Universitätskliniken oder genetischen Forschungszentren.
6.4 Soziologie, Netzwerkforschung und soziale Mobilität
Die genealogische Verknüpfung der Bevölkerung erlaubt tiefe Einblicke in soziale Strukturen und deren Wandel:
Analyse von Verwandtschaftsnetzwerken: Welche Familienlinien waren besonders stark vernetzt? Gab es „Zentralfamilien“ mit überdurchschnittlichem Einfluss?
Untersuchung von sozialer Reproduktion: Inwiefern wurden Berufe, sozialer Status, politische Ämter oder kirchliche Funktionen vererbt?
Erforschung von sozialer Mobilität und deren Grenzen – etwa im Vergleich zwischen Linien, die im Tal blieben, und jenen, die auswanderten oder aufstiegen.
Durch Anwendung soziologischer Netzwerkanalyse lassen sich verwandtschaftsbasierte Machtstrukturen in Politik, Wirtschaft und Kirche sichtbar machen.
6.5 Kulturgeschichte, Namensforschung und Mentalitätsgeschichte
Auch kulturhistorische Aspekte lassen sich mithilfe des Stammbaums erforschen:
Namenspersistenz und -wandel: Welche Familiennamen verschwinden, welche bestehen fort? Wie verändern sich Tauf- und Rufnamen über die Jahrhunderte?
Analyse religiöser oder kultureller Prägungen durch Namensgebungen (z. B. Bibelnamen, Vornamen-Traditionen innerhalb von Familien).
Erforschung von beruflichen und kulturellen Traditionslinien, z. B. Pfarrerdynastien, Handwerksfamilien, Lehrerfamilien oder Sängerfamilien.
Mentalitätsgeschichte anhand von Lebensläufen, Heiratsverhalten, Altersstrukturen und Familiendynamiken.
Solche Studien liefern Einblicke in Werte, Normen und kollektive Handlungsmuster, die über Generationen hinweg in Familien und Gemeinden tradiert wurden.
Fazit
Die interdisziplinäre Relevanz des Glarner Stammbaums ist außergewöhnlich hoch. Er verbindet quantitative Daten mit qualitativer Tiefe, historische Tiefe mit digitaler Vernetzung, individuelle Lebensgeschichten mit kollektiven Mustern. Als solches Werkzeug ist er nicht nur für Genealogen interessant, sondern auch für Historiker, Soziologen, Mediziner, Demografen und Kulturwissenschaftler – sowohl im regionalen als auch im internationalen Vergleich.
7. Fallstudienansätze
Neben der großflächigen Analyse ganzer Bevölkerungsgruppen erlaubt der Glarner Stammbaum auch die Durchführung zielgerichteter Fallstudien, die individuelle Familien, spezifische Linien, soziale Gruppen oder regionale Besonderheiten untersuchen. Die hohe Datenqualität, die Tiefe der genealogischen Informationen sowie die Möglichkeit, verwandtschaftliche und soziale Strukturen nachzuvollziehen, machen diese Fallstudien besonders aussagekräftig.
Im Folgenden werden exemplarische Ansätze für derartige Fallstudien vorgestellt:
7.1 Vergleich von Auswanderer- und Inlandslinien
Ein klassischer Fallstudienansatz besteht im Vergleich zwischen einem Familienzweig, der im 19. Jahrhundert nach Nordamerika auswanderte, und einem verwandten Zweig, der im Glarnerland verblieb:
Untersuchung der sozialen Entwicklung beider Linien: z. B. Bildungsstand, Berufslaufbahnen, Kinderzahlen, Lebenserwartung.
Veränderung kultureller Praktiken: Namensgebung, Heiratsverhalten oder religiöse Zugehörigkeit in der neuen Welt versus in der alten Heimat.
Auflösung oder Erhalt von verwandtschaftlichen Bindungen: Gab es Rückkehrmigration? Kontakt durch Briefe? Heiraten zwischen Emigrantenkindern und Glarner Verwandten?
Der Stammbaum erlaubt eine lückenlose Dokumentation beider Linien und ihre genealogische Rückbindung bis in die gemeinsame Herkunftsfamilie.
7.2 Heiratskreise und Endogamie in abgelegenen Gemeinden
Kleine, abgelegene Kirchgemeinden im Glarnerland (z. B. Elm, Matt, Linthal) waren bis ins 20. Jahrhundert hinein stark endogam:
Wie häufig heirateten Personen innerhalb derselben Familie oder Gemeinde?
Welche Heiratskreise (z. B. Cousin/Cousine, Großneffe/Großtante) wurden gesellschaftlich akzeptiert?
Gibt es Hinweise auf bewusste oder ökonomisch motivierte Partnerwahl?
Diese Fallstudien liefern auch Erkenntnisse zur sozialen Kontrolle, zur Rolle der Kirche bei Eheerlaubnissen und zu regionalen Normen im Heiratsverhalten.
7.3 Berufsdynastien und soziale Reproduktion
Der Stammbaum erlaubt die Untersuchung von familiären Berufstraditionen über viele Generationen hinweg:
Beispiel: Eine Familie von Lehrern, Pfarrern, Müllern oder Textilunternehmern.
Fragen: Wie wurde Wissen, Kapital oder gesellschaftliches Prestige innerhalb der Familie weitergegeben? Welche Brüche (z. B. durch Auswanderung, Heirat) gab es? Welche Rolle spielten Heiratsnetzwerke für den Erhalt von Berufsständen?
Besonders im Bereich der Textilindustrie (z. B. im Sernftal) lassen sich ganze industrielle Verwandtschaftsnetzwerke rekonstruieren.
7.4 Familiäre Vererbung von Namen und Eigenschaften
Ein weiterer möglicher Ansatz ist die Untersuchung der Namensvererbung:
Wie wurden Vornamen über Generationen weitergegeben? Gab es bestimmte Namensmuster (z. B. nach Großeltern oder Paten)?
In welchen Familien wurden traditionelle oder religiös geprägte Namen über Jahrhunderte gepflegt?
Gibt es Zusammenhänge zwischen Namen und bestimmten Funktionen, z. B. in Pfarrerfamilien?
Auch vererbte Eigenschaften (z. B. künstlerische Talente, Sprachkenntnisse, musikalische Begabung) könnten über Interviews und externe Daten ergänzt und genealogisch verankert werden.
7.5 Auswirkungen historischer Ereignisse auf Familienstrukturen
Der Stammbaum kann genutzt werden, um die Auswirkungen spezifischer historischer Ereignisse auf einzelne Familien zu untersuchen:
Spanische Grippe (1918–1920): Welche Familien verloren mehrere Mitglieder? Gab es Nachwirkungen im Heiratsverhalten oder der Familienplanung?
Dreissigjähriger Krieg: Welche Linien wanderten aus? Welche starben aus? Wer kehrte zurück?
Hungersnöte oder Naturkatastrophen: Z. B. Murgänge, Lawinen oder Viehseuchen und ihre Auswirkungen auf Geburten, Heiraten oder Migration.
Solche Studien kombinieren genealogische Daten mit sozialhistorischer Kontextanalyse und lassen sich hervorragend publizieren oder museal aufbereiten.
7.6 Matrilineare versus patrilineare Verbindungen
Ein ungewöhnlicher, aber spannender Ansatz wäre die Fokussierung auf matrilineare Linien:
Welche genealogischen Informationen bleiben erhalten, wenn man mütterlichen Linien folgt?
Wie stark sind weibliche Rollen in der Vererbung von Namen, Status oder Kultur genealogisch sichtbar?
Diese Studien bieten eine alternative Perspektive auf traditionelle, oft patrilinear geprägte Genealogie.
Fazit
Fallstudien bieten eine wertvolle Möglichkeit, die abstrakte Tiefe der Datenbank mit konkreten historischen Fragestellungen zu verbinden. Sie schaffen anschauliche Zugänge zu langen genealogischen Linien, verdeutlichen historische Prozesse anhand von Lebenswegen und erlauben es, Brücken zwischen Mikro- und Makroanalyse zu schlagen. Der Glarner Stammbaum bietet dafür eine ideale Grundlage, sowohl für wissenschaftliche Arbeiten als auch für Ausstellungen, Bildungsprojekte oder populärwissenschaftliche Formate.
8. Ausblick
Der Glarner Stammbaum stellt ein einzigartiges, multidisziplinär nutzbares Forschungsinstrument dar. Seine Tiefe, Breite und zeitliche Kontinuität machen ihn zu einer wertvollen Ressource nicht nur für die Regionalforschung, sondern auch für übergeordnete Fragestellungen der Sozial-, Kultur- und Gesundheitswissenschaften. Eine stärkere institutionelle Anbindung und internationale Vernetzung könnten das Potenzial dieser Datenbank weiter erschließen.
9. Literaturhinweise (Auswahl)
BLUMER JOHANN JAKOB. Urkundensammlung zur Geschichte des Kantons Glarus. Glarus 1865
HÖPFLINGER FRANCOIS. A short Population History of Switzerland. Zürich 2025
KUBLY-MÜLLER JOHANN JAKOB. Genealogisches Kompendium der Familien geordnet nach den Kirchgemeinden des Kantons Glarus. 36 Bände. Glarus 1893-1923 (mit Nachführungen in die Neuzeit)
MANDEMAKERS KEES / ALTER GEORGE / VÉZINA HÉLÈNE, PUSCHMANN PAUL. Sowing – the Construction of Historical Longitudinal Population Databases. Radbound University Press, Nijmegen, 2023
MANRUBIA SUSANNA C. / ZANETTE DAMIAN H. At the Boundary between Biological and Cultural Evolution: The Origin of Surname Distributions. arXiv 2002
MATTHIJS KOEN, HIN SASKIA, KOK JAN, MATSUO HIDEKO. The future of historical demography – Upside down and inside out. Leuven 2016
PFISTER CHRISTIAN. Bevölkerungsgeschichte und historische Demographie 1500 – 1800. München 1994
TSCHUDI-SCHÜMPERLIN IDA / WINTELER JAKOB. Wappenbuch des Landes Glarus. Wappen der Glarner Geschlechter von der ältesten Zeit bis zur Gegenwart. In Verbindung mit einem Verzeichnis sämtlicher Bürgergeschlechter des Landes. Genf 1937
VEGE OROZCO CARMEN D. / GOLAY JEAN / KANEVSKI MIKHAIL. Multifractual Portrayal of the Swiss Population. arXiv 2013
WINTELER JAKOB. Das Land Glarus. Chronik seiner Landschaft, Geschichte, Kultur und Wirtschaft. Zürich 1945


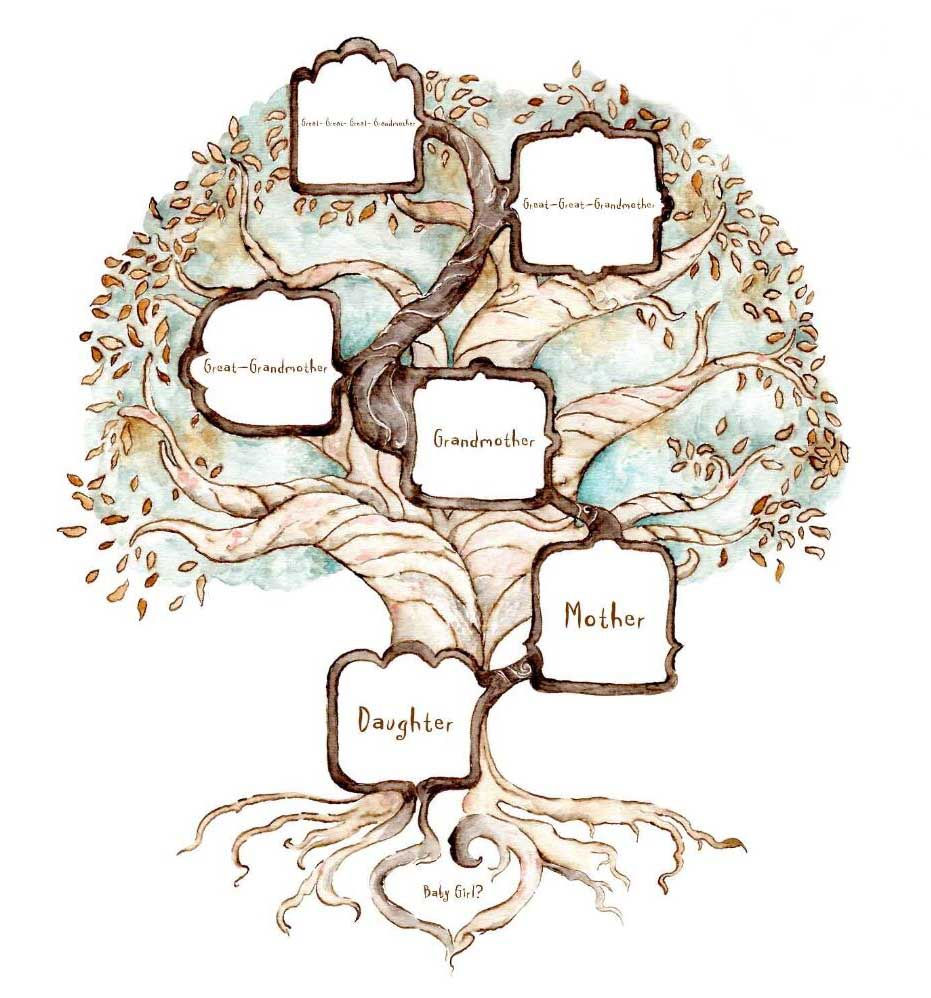
Kommentare