Wenn “die Schwindsucht” den Tod brachte
- Patrick

- 5. Aug.
- 2 Min. Lesezeit
Wer sich mit Ahnenforschung beschäftigt, kennt das Phänomen: Man stößt auf Sterbebücher, Kirchenregister oder alte Chroniken – und findet dort Begriffe wie „Schwindsucht“, „Wassersucht“ oder gar „die böse Hitze“. Was sich liest wie aus einem düsteren Roman, waren einst echte medizinische Diagnosen. Doch was genau verbarg sich hinter diesen Bezeichnungen?

Medizinische Zeitreise: Zwischen Aderlass und Aberglaube
Bevor es Röntgenbilder, Labordiagnostik und moderne Antibiotika gab, war das Verständnis von Krankheiten eng mit dem sichtbaren Leiden verknüpft. Man beobachtete Symptome – Abmagerung, Verfärbung, Fieber – und gab ihnen Namen. Nicht selten spiegelten diese Namen den kulturellen Kontext, den Glauben oder sogar politische Feindbilder wider.
Die „Franzosenkrankheit“ etwa, war nicht etwa ein französisches Leiden, sondern ein anderer Name für Syphilis. Andere Nationen nannten sie die „Neapolitanische Krankheit“ oder die „Polnische Krankheit“, je nachdem, wen man dafür verantwortlich machen wollte.
Wenn „Schwulst“ nicht schön war
Viele Bezeichnungen wirken heute harmlos, hatten aber dramatische Bedeutungen. Hinter dem Begriff „Schwulst“ verbarg sich eine Geschwulst, ein Tumor oder ein Geschwür. Der „Stich“ war keine Insektenverletzung, sondern stand für Lungenentzündung – vermutlich, weil der Brustschmerz bei einer Pneumonie oft als stechend empfunden wurde.
„Blödsinnig“ und „Insanus“ sind heute glücklicherweise medizinisch überholt. Sie waren Sammelbegriffe für psychische Erkrankungen, geistige Behinderungen oder Verhaltensauffälligkeiten – lange vor der Entwicklung moderner Psychiatrie.
Von der „Sucht“ zum Symptom
Interessant ist auch der alte Gebrauch des Wortes „Sucht“. Es bedeutete nicht zwangsläufig Abhängigkeit, sondern war ein Sammelbegriff für Leiden – man sprach etwa von „Wassersucht“ (Ödem), „Lungensucht“ (Tuberkulose) oder „Fallsucht“ (Epilepsie).
Das berüchtigte „Faulfieber“, oft in Verbindung mit unhygienischen Bedingungen erwähnt, war meist Typhus oderFleckfieber – Krankheiten, die durch Läuse und schlechte Hygiene übertragen wurden.
Ahnenforschung mit medizinischem Wörterbuch
Für Familienforscher ist das Wissen um diese alten Begriffe Gold wert. Nur wer die damaligen Krankheitsbezeichnungen deuten kann, versteht die Lebensumstände seiner Vorfahren richtig. War ein Vorfahre „bresthaft“, bedeutet das nicht, dass er ein Hypochonder war – sondern schlicht „gebrechlich“. Hinter „Fäule“ verbarg sich mitunter Krebs, „Gries“ deutete auf Nierensteine, und bei „Gicht“ handelte es sich um eine schmerzhafte Stoffwechselerkrankung.
Warum wir hinschauen sollten
Das Lesen alter Krankheitsbezeichnungen ist nicht nur eine akademische Übung. Es eröffnet ein Fenster in die Welt unserer Ahnen – ihre Ängste, ihr Leiden, aber auch ihren Umgang mit Krankheit und Tod. In einer Zeit ohne Krankenhäuser, ohne Antibiotika, ohne Impfungen war das Wissen um Symptome überlebenswichtig – und wurde durch Sprache überliefert.
Fazit: Sprachgeschichte trifft Familiengeschichte
Alte Krankheitsbezeichnungen sind mehr als nur medizinische Fachbegriffe vergangener Zeiten – sie sind sprachliche Zeugen des Alltags, der Sorgen und der Weltbilder unserer Vorfahren. Wer sie zu deuten weiß, kann genealogische Quellen besser verstehen und die Lebensumstände der eigenen Ahnen präziser einordnen.
Zur Vertiefung habe ich eine Übersicht mit den wichtigsten historischen Krankheitsbezeichnungen samt heutiger Bedeutung und kurzer Erklärung zusammengestellt.Du kannst das Dokument hier kostenlos herunterladen:


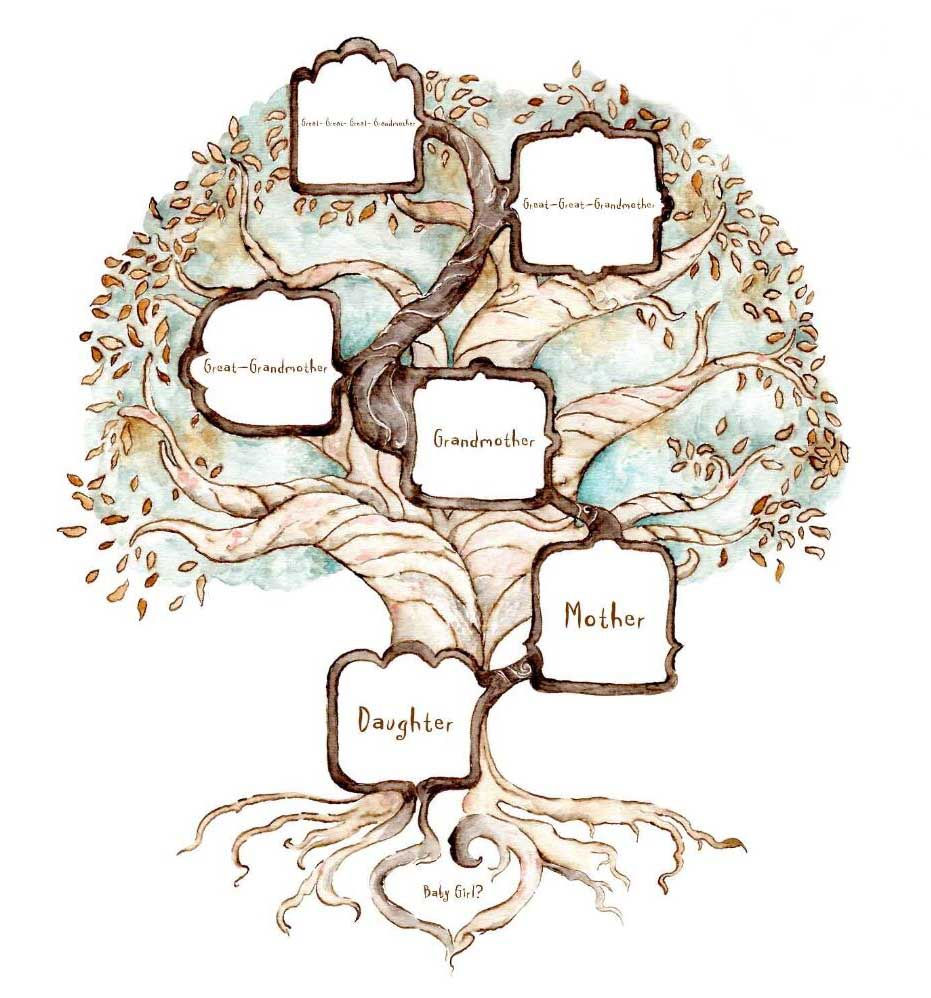
Kommentare